
Einstieg in Open Educational Resources
Open Educational Resources (OER) sind frei verwendbare Lernmaterialien. Hierfür werden die Materialien unter einer speziellen Lizenz veröffentlicht und, meist via Internet, öffentlich zugänglich gemacht.
OER-Materialien eröffnen Studierenden zusätzliche Möglichkeiten des Lernens, die ggf. besser zu ihren jeweiligen Lernmethoden und -präferenzen passen. Für Lehrende stellen sie Ressourcen dar, die sie – sei es unverändert oder angepasst – in ihre eigenen Lehrmaterialen integrieren können.
Dank der grosszügigen Konditionen für ihre Verwendung sind Open Educational Resources auch nützlich für die Vorbereitung einer Publikation, sei dies ein Artikel, ein Buch oder ein Video: Im Gegensatz zu gewöhnlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten können OER-Materialien verwendet, angepasst und weiterverbreitet werden wie es beliebt und ohne die ursprünglichen Autor:innen um Erlaubnis fragen zu müssen.
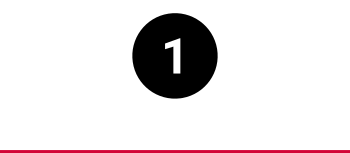
Was sind Open Educational Resources?
Überblick
Vorstellungen von Open Educational Resources (OER) sind meist sehr technisch. Das liegt daran, dass sie viele verschiedene Dimensionen berücksichtigen müssen - einschliesslich rechtlicher, technologischer und didaktischer Aspekte. Die Idee hinter Open Educational Resources ist jedoch leicht zu verstehen, wenn man die beiden Ziele ihrer Vertreter:innen kennt:
- Der Zugang zu Lernmaterialien soll für Lernende einfacher und günstiger sein, da die Verbreitung von Wissen im Interesse einer demokratischen Gesellschaft liegt.
- Der Austausch von Lernmaterialien unter Lehrenden soll erleichtert werden, da er zahlreiche Vorteile hinsichtlich Inspiration und Effektivität mit sich bringt.
Definition der UNESCO
Heutzutage können diese beiden Ziele erreicht werden, indem die Veröffentlichung von Lernmaterialien durch so genannte «offene Lizenzen» (unten genauer beschrieben) erleichtert wird. Entsprechend hat die UNESCO 2012 die Open Educational Resources wie folgt definiert:
OER sind Lehr-, Lern- und Forschungsmaterialien jeglicher Art - digital oder nicht -, die gemeinfrei sind oder unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden, die den kostenfreien Zugang, die Nutzung, die Anpassung und die Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringen Einschränkungen erlaubt.
Im Folgenden werden die verschiedenen Elemente dieser komplexen Formulierung Schritt für Schritt erläutert.
Kostenfreier Zugang, Nutzung, Anpassung und Weiterverbreitung
Die Ersteller:innen von OER-Materialien gewähren den Nutzer:innen das Recht,
- eine Kopie des Materials zu besitzen,
- das Material beliebig und privat oder öffentlich zu verwenden,
- das Material zu verändern, auch durch die Kombination mit eigenen Inhalten oder mit anderen gemeinfreien Inhalten,
- das Material, ob verändert oder nicht, erneut zu veröffentlichen, und zwar
- ohne die ursprünglichen Urheber:innen fragen zu müssen und
- ohne finanzielle Entschädigung für die ursprünglichen Urheber:innen.
Unterschiedliche Auffassungen von «openness»
Um der UNESCO-Definition von «Offenheit» zu entsprechen, müssen Open Educational Resources alle sechs oben genannten Bedingungen erfüllen.
Beachten Sie jedoch, dass der Begriff «offen» häufig auch im weiteren Sinne von «frei weiterverbreitbar» verwendet wird: Im wissenschaftlichen Kontext erlauben einige Open-Access-Materialien beispielsweise nur die Weitergabe «im Originalzustand», also ohne Änderungen, und erfüllen damit die oben genannte Bedingung 4 nur zum Teil. Dies wird mitunter als «gratis Open Access» (im Gegensatz zu «libre Open Access», der auch die Weitergabe von überarbeiteten Inhalten gestattet) bezeichnet.
Manchmal wird der Begriff «offen» sogar auf jede Form von öffentlich zugänglichem Material angewandt, wie z. B. YouTube-Videos. Dies überdehnt den Begriff aber wohl, da es hier den Nutzer:innen in den meisten Fällen nicht gestattet ist, eine private Kopie der Materialien zu besitzen (Bedingung 1) oder sie in irgendeiner Weise zu nutzen, die über das private Ansehen, Anhören oder Lesen hinausgeht. In einigen Fällen – z.B. auf Streaming-Plattformen – ist selbst die Speicherung einer privaten Kopie der Materialien (Bedingung 1) nicht möglich.
Urheberrecht
Ein Originalwerk, das von einer Person geschaffen wurde, steht ab dem Zeitpunkt seiner Entstehung (d. h. vor einer Veröffentlichung) automatisch unter dem Urheberrecht. Ein geschütztes Werk entsteht, wenn die drei folgenden Kriterien erfüllt sind:
- Die Schöpfung muss dem Geist eines Menschen entspringen – Naturescheinungen (Gestein, Pflanzen) sowie das, was von Tieren oder Maschinen (auch Computers) hergestellt wird, können kein urheberrechtlich geschütztes Werk sein.
- Das Werk muss einen individuellen Charakter haben: Es muss «Individualität oder Originalität aufweisen», d. h. sich «vom allgemein Üblichen und Alltäglichen abheben» (aus: CCDigitallaw).
- Das Werk muss eine greifbare Form haben (Begriffe und Ideen im Kopf können nicht urheberrechtlich geschützt werden).
Was das Urheberrecht betrifft, so unterscheiden die Schweiz und andere europäische Länder zwischen dem «Urheberpersönlichkeitsrecht» und dem «Eigentumsrecht».
Urheberpersönlichkeitsrecht: Dieses Recht umfasst zwei zentrale Aspekte: Erstens die Freiheit zu entscheiden, ob und wie ein Werk genutzt, angezeigt oder verbreitet werden soll. Zweitens das Recht, als Schöpfer:in eines Werkes anerkannt und zitiert zu werden, insbesondere durch Nennung des eigenen Namens in Verbindung mit dem Werk. Dieses Recht ist nicht übertragbar und hat keine zeitliche Begrenzung.
Vermögensrecht: Hier geht es um das Recht, zu bestimmen, ob, wann und wie ein Werk verwendet werden kann. Das Werk kann sowohl kommerziell (sprich gegen Vergütung) wie nicht-kommerziell verwertet werden. Dieses Recht ist zeitlich begrenzt: In der
Regel dauert es 70 Jahre nach dem Tod der Urheber:innen. Das Vermögensrecht ist
übertragbar, so dass die Urheber:innen oder ihre Erbinnen/Erben beschliessen können,
dass andere das Werk für sie verwerten, in der Regel gegen Bezahlung.
So kann beispielsweise ein:e Autor:in das Recht zur Verwertung eines Romans an einen Verlag übertragen, der dann für den Druck, den Vertrieb, die Vermarktung und natürlich den Verkauf des Werks verantwortlich ist. Im Gegenzug handelt der/die Autor:in z. B. einen Vorschuss oder Tantiemen für die verkauften Auflagen aus.
Beachten Sie die folgenden Ausnahmen des Urheberrechts:
- Das Zitatrecht gewährleistet, dass Auszüge aus urheberrechtlich geschütztem Material zur Veranschaulichung in die eigene Arbeit aufgenommen werden dürfen, wobei die Quelle stets deutlich angegeben werden muss.
- Urheberrechtlich geschütztes Material kann in Bildungskontexten verwendet werden, sofern bestimmte Bedingungen dafür erfüllt sind (siehe hier für Details).
- Nutzer:innen können urheberrechtlich geschütztes Material im privaten Bereich (z. B. unter Familienmitgliedern oder in kleinen Gruppen von Freunden) frei verwenden.
Gemeinfreies Material
In vielen Ländern, darunter auch in der Schweiz, erlischt das «Eigentumsrecht» des Urheberrechts 70 Jahre nach dem Tod der Schöpferin/des Schöpfers (in einigen Ländern gelten kürzere oder längere Fristen). Von diesem Zeitpunkt an wird das Werk gemeinfrei. Gemeinfreie Werke können von jeder Person frei verwendet werden.
Auch wenn dies nicht in allen Fällen notwendig ist, gehört es zur guten Vorgehensweise, die ursprünglichen Schöpfer:innen zu nennen, um Plagiatsvorwürfe zu vermeiden.
Gemeinfreie Werke sind Open Educational Resources im Sinne der UNESCO, da sie alle sechs oben genannten Bedingungen erfüllen.
Zu beachten ist, dass die Ausgaben generativer KI-Tools (z. B. grosser Sprachmodelle wie ChatGPT oder Mistral, Bildgeneratoren wie DALL-E oder Stable Diffusion) rechtlich keinen Autor haben. Sie gelten daher als gemeinfrei. Allerdings kann an solchen Ausgaben ein Urheberrecht entstehen, wenn Nutzer:innen sie substanziell überarbeiten -- sei es durch direkte Änderungen oder durch iterative Prompt-Optimierung.
Offene Lizenzen
Wie oben erläutert, beinhaltet das Urheberrecht das Recht, frei zu entscheiden, wie ein Werk genutzt, gezeigt oder verbreitet werden soll, wenn überhaupt. Zu diesem Zweck können die Urheber:innen beschliessen, andere zu berechtigen, das Werk kommerziell zu verwerten.
Die Idee hinter offenen Lizenzen ist, dass Schöpfer:innen das Urheberrecht nicht nur zur Einschränkung, sondern auch zur weiteren Verbreitung eines Werks nutzen können. Dies erfolgt durch die Erteilung einer automatischen Lizenz an die Nutzenden, das Werk in einer bestimmten Art und Weise zu verwenden. Zum Beispiel können Schöpfer:innen ihr Werk so lizenzieren, dass sie Nutzenden die verschiedenen Freiheiten einräumen, die oben im Abschnitt zu offenen Materialien aufgeführt sind.
Für kulturelle Werke wie Musik, Bild oder Text sind die beliebtesten offenen Lizenzen diejenigen, die von der Creative Commons Foundation definiert wurden. Die verschiedenen Creative-Commons-Lizenzen werden im Folgenden besprochen.

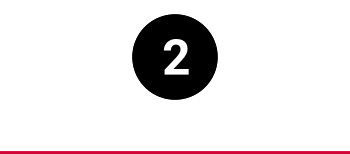
Creative-Commons-Lizenzen
Die Creative Commons Foundation
Die Creative Commons Foundation ist eine US-amerikanische Organisation, die im Jahr 2001 von Prof. Lawrence Lessig, einem Professor der Harvard Law School und Aktivisten für «Internet Freedom», gegründet wurde. Ziel der Stiftung ist es, eine weltweite Kultur der Wieder- und Neuverwendung und des Austauschs zu fördern.
Wie oben erläutert, müssen offene Lizenzen den Nutzer:innen mindestens das automatische Recht einräumen, eine Kopie des Materials zu behalten und es beliebig an andere weiterzugeben. Dies ist jedoch nur eine minimale Definition von Offenheit: Die UNESCO-Definition von Open Educational Resources beschreibt sie näher.
Die Creative Commons Foundation hat mehrere Lizenzen definiert, um Urheber:innen zu helfen, ihre Materialien mit dem Grad an Offenheit zu veröffentlichen, der für sie am besten passt. Diese Lizenzen, genannt Creative-Commons-Lizenzen (oder kurz CC-Lizenzen), sind die weltweit am häufigsten verwendeten Lizenzen für geistige und kulturelle Werke.
Für andere Arten von urheberrechtsfähigen Materialien werden andere Lizenzen verwendet, auf die in diesem Dokument nicht näher eingegangen wird:
- Eine Einführung in die Lizenzierung von Daten finden Sie auf dieser Webseite der Open Knowledge Foundation;
- Für Software bietet die Open Source Initiative eine umfassende Lizenzliste; auch nützlich sind die Lizenzempfehlungen der Free Software Foundation, die hier abrufbar sind.
Wie Sie Ihre Materialien lizenzieren
Es gibt keine allgemeingültige Regel, um zu entscheiden, wie geschlossen oder offen eine Ressource sein sollte. Meist ist dies eine Frage der persönlichen Präferenz. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige allgemeine Überlegungen und Empfehlungen zu diesem Thema vor.
Für die Freigabe von Inhalten jeglicher Art als offene Ressource reicht es in der Praxis aus, den Namen der Lizenz auf oder in dem Werk selbst anzugeben (z. B. auf der ersten Seite eines Buches oder im Abspann eines Videos).
Die Nutzer:innen müssen Zugang zu den detaillierten Bedingungen der Lizenz haben, welche aber nicht direkt im Werk enthalten sein müssen: Es ist zulässig, lediglich einen Verweis oder einen Link zur vollständigen Erklärung der Bedingungen im Werk anzugeben.
Beachten Sie, dass offene Lizenzen den Nutzer:innen ein dauerhaftes Recht einräumen, das von den Urheber:innen nicht widerrufen werden kann. Jedoch können Urheber:innen neue Versionen eines Werkes veröffentlichen und dabei die Lizenz wechseln.
Die sechs CC-Lizenzen
Die Creative Commons Foundation bietet eine Auswahl von sechs verschiedenen Lizenzen an. Wir stellen sie hier der Reihe nach vor, beginnend mit den restriktiveren CC-Lizenzen, den sogenannten «NoDerivatives-CC-Lizenzen».

Die CC-Attribution-NoDerivatives-Lizenz erlaubt den Nutzer:innen, das Material kommerziell oder nicht kommerziell weiterzuverbreiten, jedoch nur wortgetreu, d. h. ohne jegliche Änderung.

Die CC-Attribution-NoDerivatives-Non-Commercial-Lizenz erlaubt den Nutzer:innen, das Material weiterzuverbreiten, jedoch nur nicht-kommerziell und wortgetreu, d. h. ohne jegliche Änderung.
Anmerkung
Wie der Name schon sagt, erlauben die nicht-derivativen CC-Lizenzen den Nutzer:innen nicht, modifizierte Materialien weiterzuverbreiten. Dementsprechend können sie nicht für Open Educational Resources im Sinne der UNESCO-Definition verwendet werden. Sie können jedoch unter anderem für Open-Access-Publikationen verwendet werden.
Viele (darunter z. B. die Free Software Foundation) argumentieren, dass sich CC-No-Derivatives-Lizenzen für Meinungsäusserungen oder Materialien mit hohem persönlichen Gehalt eignen. Um eine Meinung zu verteidigen und weiterzuverbreiten, ist es sinnvoll, die freie Weiterverbreitung zu erlauben. Um jedoch zu vermeiden, dass Verwirrung über das Gesagte entsteht, bietet es sich an, nur wortgetreue Kopien zu erlauben, um den Inhalt zu schützen. Alle CC-Lizenzen verlangen bereits, dass Änderungen am Werk deutlich angegeben werden – weiterverbreitetes Material sollte nicht den Eindruck erwecken, dass die ursprüngliche Autor:innenschaft das geänderte Werk unterstützt. Dennoch ist das Verbieten von Derivaten ein noch sichereres Mittel, um falsche Zuschreibungen zu verhindern.

Die CC-Attribution-Lizenz erlaubt den Nutzer:innen, das Material zu verändern und die modifizierte Version weiterzuverbreiten, ob kommerziell oder nicht.
Anmerkung
Dies ist die offenste (im Sinne der UNESCO) der CC-Lizenzen. Beachten Sie, dass mit dieser Lizenz das Originalwerk gewinnbringend verkauft werden kann, ohne dass die ursprünglichen Schöpfer:innen des Werkes eine Vergütung erhalten: Eine Veröffentlichung im Internet unter einer CC-BY-Lizenz kann beispielsweise als PDF-Broschüre oder E-Book aufbereitet und in Online-Buchläden verkauft werden (um dies zu verhindern, sollte CC BY-NC gewählt werden: siehe unten). Ausserdem haben Personen, die das Originalwerk in ausreichendem Masse verändern, das Recht, die veränderte Version urheberrechtlich zu schützen (um dies zu verhindern, sollte CC BY-SA gewählt werden: siehe unten). Wenn man sich für die CC-BY-Lizenz entscheidet, sollte man sich über diese beiden Möglichkeiten im Klaren sein.

Die CC-Attribution-Non-Commercial-Lizenz erlaubt Nutzer:innen, Material zu verändern und dieses weiterzuverbreiten, allerdings nur zu nicht-kommerziellen Zwecken.
Anmerkung
Siehe obige Einschätzungen.

Die CC-Attribution-Share-Alike-Lizenz erlaubt den Nutzer:innen, Material zu modifizieren und die veränderte Version weiterzuverbreiten, ob kommerziell oder nicht und nur, wenn das veränderte Material unter derselben Lizenz veröffentlicht wird.
Anmerkung
Der Vorteil von Share-Alike-Lizenzen besteht darin, dass die ursprünglichen Urheber:innen von jeder späteren Änderung an ihrem ursprünglichen Werk profitieren können. Wenn z. B. Übersetzer:innen eine Übersetzung unter einer solchen Lizenz veröffentlichen, stellen sie sicher, dass sie später jede Verbesserung oder Korrektur darin integrieren können. Viele Lizenzen für kostenfreie Software, wie z. B. die GNU Public License, setzen das Share-Alike-Prinzip um. Dahinter steht der Gedanke, dass die Gesellschaft davon profitieren kann, wenn viele Programmierer:innen ihre Verbesserungen an einer bestimmten Programmbasis gemeinsam nutzen – was deshalb möglich ist, weil sie durch die Lizenz dazu verpflichtet sind, ihre Änderungen am Originalwerk offenzulegen.

Die CC-Attribution-Share-Alike-Non-Commercial-Lizenz erlaubt den Nutzer:innen, Material zu modifizieren und die veränderte Version weiterzuverbreiten, aber nur, wenn die veränderten Materialien nicht-kommerziell weitergegeben und unter derselben Lizenz veröffentlicht werden.

CC Zero ist keine Lizenz, sondern eine Deklaration, dass die Urheber:innen auf jegliche Rechte an ihrem Werk verzichten, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Anmerkung
In einigen Rechtsordnungen – darunter die Schweiz – ist der im Urheberrecht verankerte Persönlichkeitsschutz (vgl. oben) nicht verzichtbar. Um CC 0 trotzdem zu nutzen, wird oft anonym veröffentlicht. Dies ist besonders bei Programmcode üblich, da hier Persönlichkeitsrechte weniger im Vordergrund stehen. Auch Museen stellen Reproduktionen gemeinfreier Werke (z. B. Digitalisate) unter CC 0 zur Verfügung – vorausgesetzt, die Originale sind nicht mehr urheberrechtlich geschützt.
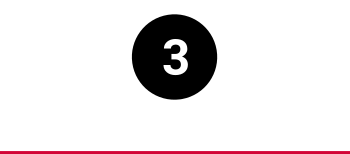
Sich an OER beteiligen
Das Prinzip der «Openness» ist ein zentraler Bestandteil der Strategie «Digitalisierung in der Lehre» der Universität Basel. Dennoch ist die Veröffentlichung von Lernmaterialien als OER keine Anforderung der Universität an ihre Lehrenden: Dies ist der Einschätzung der einzelnen Lehrenden überlassen.
Für Lehrende, die sich für das OER-Thema interessieren, steht das Team Bildungstechnologien der Universität für Beratung und Unterstützung zur Verfügung: bbit@clutterunibas.ch. Das Team bietet auch regelmäßig Fortbildungen in diesem Bereich an (die Kurse sind auf dieser Webseite aufgeführt).
Um sich an OER zu beteiligen, sind viele Optionen vorhanden. Nicht alle sind gleich intensiv. Im folgenden werden vier unteschiedliche Stufen beschrieben.

In Stufe 1 geht es darum, bestehende offene Materialien zu nutzen. Nutzer:innen beziehen OER in ihre eigene Arbeit ein – zum Beispiel verwenden sie offene Bilder in ihren Präsentationen oder integrieren offene Videos von Kolleg:innen in ihre Kurse.
Vor- und Nachteile
Nutzer:innen von OER minimieren das Risiko von Urheberrechtsverletzungen bei der Veröffentlichung oder Verwendung von Materialien. Andererseits kann es schwierig sein, offene Ressourcen zu finden, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen.
Wie vorgehen?
- Wenn Sie im Begriff sind, Inhalte zu erstellen, suchen Sie entsprechende Webseiten oder verwenden Sie Suchfilter, um offene Materialien zu finden (siehe nächstes Kapitel für nähere Informationen), sei es zur Inspiration oder um sie als Elemente in Ihre eigene Arbeit zu integrieren.
- Vergewissern Sie sich in jedem Fall, dass Sie richtig referenzieren oder zitieren und die Bedingungen der Lizenz (z. B. Share-Alike oder nur nicht-kommerzielle Nutzung) beachten.
In Stufe 2 werden OER-Materialien Materialien nicht nur verwendet, sondern auch erstellt. Bevor sie eigene Materialien verteilen, machen sich die Autor:innen Gedanken über Urheberrecht und Lizenzierung und verwenden, wenn angebracht, OER-kompatible Lizenzen.
Vor- und Nachteile
Es ist einerseits ein Dienst an anderen, immer klar anzugeben, wie sie die von Ihnen geteilten Inhalte nutzen können. Andererseits kann dies zeitaufwendig sein und die Wahl der besten Lizenz ist nicht immer einfach.
Wie vorgehen?
- Wenn Sie Inhalte erstellt haben, erleichtern Sie anderen die Wiederverwendung Ihrer Arbeit, indem Sie eine offene Lizenz wählen. Dies ist besonders dann angemessen, wenn Sie offene Inhalte in Ihrer eigenen Arbeit verwendet haben. Die Ausgaben aus generativen KI-Tools haben, wie dargestellt, keinen Urheber. Ihre Veröffentlichung unter der CC-0-Lizenz ist daher angemessen. Selbst wenn solche Ausgaben nach Überarbeitung urheberrechtlich schutzfähig werden, scheint die Wahl einer offenen Lizenz ethisch gerechtfertigt.
- Entscheiden Sie sich, wie oben beschrieben, für den Grad der Offenheit, der für Sie stimmt, und wählen Sie die entsprechende Lizenz.
- Versehen Sie Ihre Materialien mit einem Hinweis auf die gewählte Lizenz, einschliesslich eines Links zu den entsprechenden Lizenz-Bedingungen.
- Nutzen Sie Ihre Arbeit wie gewohnt (z. B. Verteilung über die Lernplattform Ihrer Universität).
In Stufe 3 werden die eigenen Materialien nicht nur als OER lizenziert, sondern sie werden zusätzlich auf hierfür geeignete OER-Plattformen bereitgestellt.
Vor- und Nachteile
Indem Sie ihre Materialien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen, unterstützen die aktiv Teilnehmenden die Verbreitung von Wissen. Dadurch, dass Sie nicht nur Inhalte nutzen, sondern auch ihre eigenen Materialien zur Verfügung stellen, geben Sie zudem anderen etwas zurück und stärken den Kreislauf des Teilens. Gleichzeitig ist dies für alle, die ein bestimmtes Qualitätsniveau ihrer Materialien anstreben, mit einem hohen Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden.
Wie vorgehen?
- Wenn Sie Inhalte erstellt haben (insbesondere solche von hoher Qualität), erleichtern Sie anderen die Wiederverwendung Ihrer Arbeit nicht nur durch die Wahl einer offenen Lizenz, sondern auch durch die Bereitstellung der Materialien auf OER-Plattformen (siehe nächstes Kapitel).
- Entscheiden Sie sich für den Grad der Offenheit, der für Sie stimmt, und wählen Sie die entsprechende Lizenz.
- Versehen Sie Ihre Materialien mit einem Hinweis auf die gewählte Lizenz, einschliesslich eines Links zu den entsprechenden Lizenz-Bedingungen.
- Entscheiden Sie sich für eine Plattform fürs Teilen und laden Sie Ihr Material dort hoch.
- Die parallele Weiterverbreitung ist natürlich erlaubt, so dass Sie Ihre Arbeit also weiterhin wie gewohnt nutzen können (zum Beispiel in Lehrveranstaltungen oder auf Ihrer Lernplattform).
In Stufe 4 werden all die oben genannten Punkte umgesetzt – und darüber hinaus wird das Thema OER vermittelt und gefördert. OER-Vermittler:innen machen zum Beispiel ihre Kolleg:innen auf die OER-Prinzipien aufmerksam, bieten Ratschläge und Hilfe an und nehmen an der internationalen OER-Diskussion teil.
Vor- und Nachteile
OER zu vermitteln und fördern ist eine Form des sozialen Engagements. Wie jedes Engagement ist auch dieses zeit- und energieintensiv.
Wie vorgehen?
- Wenn Sie diese Seite zu OER nützlich finden, empfehlen Sie sie weiter! Sie steht unter der Creative-Commons-Lizenz «Attribution–Share-Alike», deshalb können Sie sie jederzeit weiterverbreiten, auch in modifizierter Form.
- Wenn Sie auf interessante, urheberrechtlich geschützte Inhalte stossen, die Sie gerne weiterverwenden möchten, z. B. auf einer Konferenz oder im Internet, fragen Sie deren Urheber:innen, ob sie daran gedacht haben, diese Inhalte freizugeben.
- Werden Sie Teil der OER-Gemeinschaft, indem Sie in Arbeitsgruppen mitarbeiten, an offenen Veranstaltungen teilnehmen oder einer Organisation beitreten.
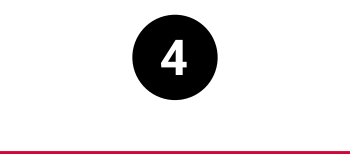
OER finden und veröffentlichen
Wo Sie offene Multimedia-Inhalte finden
Creative-Commons-Search. Eine Suchmaschine zum Erkunden von Text-, Audio- und Videomaterialien, die unter einer der Creative-Commons-Lizenzen veröffentlicht wurden. URL: https://ccsearch.creativecommons.org/
Getty Open. Getty ist eine US-amerikanische kulturelle und philanthropische Institution, die sich für die Vermittlung und Erhaltung von Kunstwerken in aller Welt einsetzt. Teile ihrer Online-Sammlungen können frei genutzt werden (CC0). URL: https://www.getty.edu/art/collection/search?open_content=true
Memobase. Memobase ist eine Schweizer Plattform für audiovisuelle Quellen und Forschungsdaten, insbesondere zu Geschichte und Kultur. Nicht alle Inhalte sind offen, aber Suchergebnisse können nach Lizenz gefiltert werden. URL: https://www.memobase.ch
MET Open Access. Das Metropolitan Museum of Art in New York bietet Online-Zugang zu seiner Sammlung und stellt viele Reproduktionen seiner Kunstwerke unter einer offenen Lizenz zur Verfügung. URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search?showOnly=openAccessg%7CopenAccess
Pexels. Eine große Online-Datenbank mit Fotos, ähnlich wie Pixabay. Ein grosser Teil der Bilder kann frei verwendet werden (CC0). Andere stehen unter einer speziellen Lizenz, die eine kommerzielle Nutzung verbietet. URL: https://www.pexels.com
Pixabay. Pixabay ist ein Online-Speicher für kostenlose Bilder, ähnlich wie Pexels. Eine grosse Anzahl von Bildern kann frei verwendet werden (CC0), während andere unter einer speziellen Lizenz stehen, die eine kommerzielle Nutzung verbietet. URL: https://pixabay.com
Wikimedia. Unterstützt von einer gemeinnützigen Stiftung, bezeichnet sich Wikimedia als eine «globale Bewegung, deren Aufgabe es ist, der Welt freie Bildungsinhalte zur Verfügung zu stellen». Neben der sehr erfolgreichen Enzyklopädie, die auf den Beiträgen der Internetgemeinschaft basiert, bietet Wikimedia auch offene Wörterbücher, Lehrbücher und Multimedia-Materialien. URL: https://www.wikimedia.org
Hinweis: Die Ergebnisse vieler Suchmaschinen, einschliesslich Google und DuckDuckGo Images und YouTube, können nach der Art der Lizenz gefiltert werden.
Wo Sie offene Lehrbücher und andere didaktische Materialien finden
Massachusetts Institute of Technology Open CourseWare. Eine sehr umfangreiche Sammlung von Lehrmaterialien, die 2001 vom MIT ins Leben gerufen wurde, mit Zugang zu vollständigen Kursen, Lehrplänen, Leselisten, Bewertungsmaterialien usw. URL: https://ocw.mit.edu
OERInfo. Dieses hochwertige deutschsprachige Online-Portal, das vom deutschen Ministerium für Bildung und Forschung unterstützt wird, bietet Links zu zahlreichen Online-Repositorien für Open Educational Resources. URL: https://open-educational-resources.de/materialien/oer-verzeichnisse-und-services/
Open Textbook Library. Eine Sammlung von Links zu hochwertigen offenen Lehrbüchern, bereitgestellt von der University of Minnesota, Minneapolis. URL: https://open.umn.edu/opentextbooks
Open Yale Courses. Diese Webseite bietet kostenlosen Zugang zu einer Reihe von offenen Kursen, die an der Yale University angeboten werden. Es sind nicht nur Videos, sondern auch Podcasts und Transkripte verfügbar, die verschiedene Lernformen ermöglichen. URL: https://oyc.yale.edu/
Wo Sie offene Ressourcen hochladen können
Figshare. Figshare ist eine Plattform zur gemeinsamen Nutzung offener Inhalte, insbesondere von Datenbanken und Open Educational Resources, die von vielen Universitäten weltweit genutzt wird. URL: https://figshare.com
Moodle.net. moodle.net ist die neue Erweiterung der internationalen Lernplattform Moodle, die speziell als Speicher für OER-Inhalte konzipiert ist. URL: https://moodle.net
Zenodo. Zenodo, das vom OpenAIRE-Projekt der Europäischen Union und dem CERN ins Leben gerufen wurde, ist eine Plattform, die sich auf Open-Source-Technologien stützt, um offene Inhalte, insbesondere wissenschaftlicher Art, wie Datenbanken, wissenschaftliche Artikel und Lernmaterialien zu veröffentlichen. URL: https://zenodo.org
